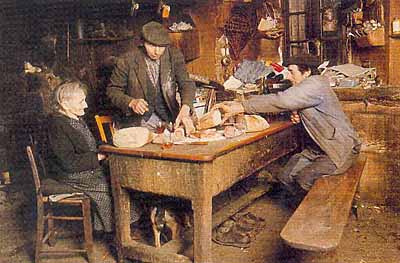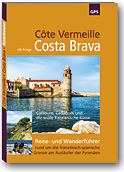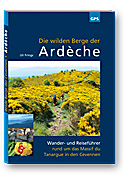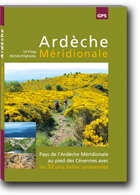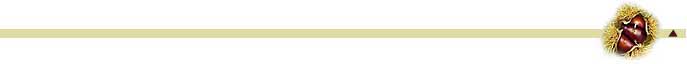Hier
die Übertragung der französischen Schularbeit ins Deutsche:
Germain Derocles, 65 Jahre, pensionierter Bauer und unverheiratet, lebt
mit seinem Bruder Aimé in zwei riesigen Häusern. Das einzige
Mal in seinem Leben, das Germain weiter weg von Valousset gekommen ist
als bis zur nächsten Stadt, war, als er in Österreich in die
Gefangenschaft gekommen ist. Diese Erfahrung, vier Jahre weg von seinem
Dorf zu sein, hat ihm eine gewisse Lebensweisheit vermittelt, und nichts
aus jener Zeit hat er je wieder vergessen. Seine Eltern waren in ihren
Ansichten sehr beschränkt (wie er fand), und so waren sein Bruder
und er in einer systematischen Ablehnung alles Neuen erzogen worden.
Zum Beispiel wollte der Vater von Germain und Aimé nicht, daß
Germain Autofahren lernt, und heute, wo Aimé ernsthaft erkrankt
ist und es kein einziges Transportmittel in der Gemeinde gibt, ist er
abhängig vom guten Willen hilfsbereiter Bauern, wenn er in die
Stadt muß.
Germain ist der einzige weit und breit, der sich nicht um die Sommerzeit
kümmert, so wie er auch der einzige ist, der keinen elektrischen
Strom hat – das macht ihm alles nichts aus. Die Sparsamkeit ist
in den Menschen tief verwurzelt; nie wird man die alten Leute hier anders
als auf einem Holzfeuer kochen sehen, und ihr Wohnraum bekommt sein
Licht von einer 20-Watt-Birne. Der Lebensmittelhändler hat uns
gesagt, diese hier benutzten Lampen bekäme man nur noch in der
Ardèche. Die Leute sind aber nicht geizig, nur sehr sparsam.
Sie sind freigiebig und teilen großmütig. Manchen Fortschritt
haben aber auch die Älteren mit der Zeit akzeptiert: als ersten
Schritt ließen sie meist fließendes Wasser bis ihren Häusern
legen. Wenn sie älter wurden und nicht mehr zum fünf Kilometer
entfernten Dorf gehen konnten, um ihre Wäsche zu waschen, kauften
manche sogar eine Waschmaschine.
Germain erzählt:
"Oh, der Berg hat sich völlig verändert. Als wir jung
waren, war das Dorf noch nicht so tot wie jetzt. Die Holzschuhe klapperten
auf dem Kopfsteinpflaster und hallten von den hölzernen Fußböden;
man hörte überall die Stimmen von Menschen und von Tieren,
ja wirklich, das Dorf lebte noch... Jetzt gibt es nur noch 17 Menschen,
wo es doch früher ungefähr hundert waren. Jeder lebte von
den Produkten seines Landes, und diejenigen, die kein Land hatten, waren
sehr arm und lebten als arme Schlucker. Sie arbeiteten mühevoll
für andere, und wenn sie dazu nicht mehr in der Lage waren, lebten
sie von der Barmherzigkeit anderer - falls sie keine Kinder hatten,
die sich um sie kümmerten... Wir haben Familien gekannt, höher
in den Bergen, die so arm waren, daß sie nicht einmal Betten hatten,
um darin zu schlafen. Sie schliefen auf Gras oder auf Farnstreu. Das
war wirklich elende Armut. Zum Glück hatten die meisten Menschen
irgendetwas, wovon sie karg, aber anständig leben konnten.
Der Berg war in dieser Zeit noch gut versorgt; man muß sich vorstellen,
daß jeder Grashalm seinen Platz hatte; kein einziger Brombeerstrauch
hatte Zeit oder Platz zu wachsen. Auf den Hügeln des Bergs waren
Äcker angelegt, Terrassen (Faisses), die durch Steinmauern gestützt
wurden – Steine, die unsere Vorfahren aus den großen Felsen
zu brechen wußten. Sie bauten wahre Meisterwerke, völlig
ohne Zement. Jede Terrasse wurde mit der nächsten durch kleine
Treppen von höchstens 30 oder 40 Zentimetern Breite – um Platz
zu sparen – verbunden. Zu dicke Menschen mußten sie seitlich
herauf- oder heruntergehen, aber zu dicke Menschen gab es zu dieser
Zeit auch nicht viele.
Jedes Stückchen boden hatte seine Bestimmung, nichts lag brach,
wenn es nicht zwingende Gründe dafür gab. Jeder Baum wurde
auf eine Stelle gepflanzt, über die man lange nachgedacht hatte:
Mit Vorliebe an den Rand der Faisses, um den Ackerbau nicht zu behindern.
Daß das Pflücken der Früchte dadurch nicht einfacher
wurde, nahm man in Kauf.
In den Feldern war damals kein Ginster und kein Farn zu sehen, während
heute alles erstickt und die Wege überwuchern, so daß man
ohne Baummesser gar nicht mehr durchkommt. Früher holte man diese
Pflanzen hoch oben von den Bergweiden und mußte sogar dafür
bezahlen. Aus Farn wurden Matratzen gemacht, Ginster brauchte man, um
Feuer anzumachen, Licht zu geben oder Besen herzustellen. Bei uns zuhause
steckte meine Mutter einen Ginsterzweig an, wenn sie des Abends die
Suppe auftrug, und wir mußten unsere vollen Teller leer essen,
bevor der Ginsterzweig heruntergebrannt war – ansonsten mußte
man alleine im Dunkeln beim Schein des Feuers weiteressen, oder aber
den Rest der Suppe bis zum folgenden Morgen stehenlassen. Das heißt
Sparen! Ginster war für die Beleuchtung nicht zu teuer, Öl
aber wohl!
Die Arbeit als Fuhrmann
Mein Vater arbeitete als Fuhrmann für das Dorf. Er stand morgens
um vier Uhr auf und zog mit den Mauleseln Richtung Largentière.
Weil es bis zu unserem Dorf noch keinen Weg gab, ließ er den Wagen
immer in unserer großen Scheune am Wegrand drei Kilometer vor
dem Dorf zurück, das war dann der Endpunkt. Von da aus mußten
die Waren auf dem Rücken eines Maultieres transportiert werden
– für die, die es sich leisten konnten, oder auf dem Rücken
eines Menschen, für die Allerärmsten. Aus unserem Dorf brachte
mein Vater die wenigen Waren weg, die wir verkaufen konnten – ein
bißchen Mehl, Wein, Gemüse, Geflügel oder Schweine,
die einige Dorfbewohner zum Verkaufen mästeten. Aus der Stadt brachte
er Produkte mit, die wir im Dorf nicht selbst herstellen konnten und
die wir früher oder später doch kaufen mußten. Die wichtigste
Fracht bestand aus verschiedensten Baumaterialien. Manchmal nahm er
auch Passagiere mit, aber man durfte es nicht eilig haben, denn er hielt
bei jeder kleinen Kneipe unterwegs an (und das waren so ungefähr
fünfzehn), auf dem Hinweg ebenso wie auf dem Rückweg, einmal,
um zu sehen, ob es etwas für ihn zu tun gäbe, aber auch, weil
er unmöglich vorbeifahren konnte, ohne zu halten und ein "canon"
(ein Gläschen) zu trinken. Es kam sogar vor, daß er den ganzen
Tag schwer gearbeitet hatte und im Dunkeln nach Hause kam, und alles,
was er verdient hatte, war vertrunken. Aber es zwangen ihn auch die
Umstände dazu, es ging nicht anders, wenn man es jedem recht machen
wollte.
Arbeit auf dem Hof
In all dieser Zeit arbeitete meine Mutter hart auf dem Bauernhof, und
wir halfen ihr, so gut wir konnten. Aber obwohl wir einen der größten
Bauernhöfe der Gegend hatten, waren wir nicht reich. Wir, die Söhne,
wollten nicht so wie unser Vater Fuhrmann werden, und so haben wir uns
Ziegen und Schafe zugelegt. Mein Bruder war der Hirte und ich arbeitete
mehr auf den Äckern.
Ein Hirte für alle
Wir hatten ungefähr hundert Tiere, die jeden Tag gehütet werden
mußten. Mein Bruder liebte es, mit den Tieren unterwegs zu sein,
und er ist sehr früh von der Schule abgegangen, um nur für
die Tiere da zu sein. Wir machten nicht mit bei dem Weidesystem des
Dorfes, wo abwechselnd gehütet wurde – dazu hatten wir selbst
zu viele Tiere. Aber das System war so interessant, daß ich Euch
davon erzählen werde:
In der Zeit, als es noch viele Schafe im Dorf gab, hatten wir einen
Hirten, der sie nach oben auf die Weiden brachte, um dort zu "übersommern".
Wenn die Herde loszog oder auch zurückkam, war das jedes Mal ein
prächtiges Schauspiel. Alle Menschen aus dem Dorf brachten ihre
Tiere zum steinernen Kreuz am Ende meines Weges. Jeder hatte die schönsten
Tiere mit Wolle und roter Farbe geschmückt. Man hing ihnen auch
Glocken um. Manche Familien hatten mehr als fünfzig Glocken –
das war unsere Art von Luxus. Es gab nichts Schöneres, als zu sehen,
wie diese Herde, so um die 1000 bis 2000 Tiere, sich in Bewegung setzte.
Der Hirte blieb oben, bis der erste Frost einsetzte. Die Jüngeren
aus dem Dorf brachten ihm abwechselnd sein Essen, oft barfuß,
denn mit Holzschuhen läßt sich nicht gut klettern, und die
guten Schuhe durften nicht verschlissen werden.
Als im Dorf immer weniger und immer ältere Menschen wohnten, wollten
sie keinen Hirten mehr für ihre Tiere bezahlen. Da hat dann von
jeder Familie einer jweils abwechselnd das Hirtenamt übernommen.
Wenn der diensttuende Hirte ein Signal hören ließ –
er blies auf einem Kuhhorn – dann verließen alle Ziegen ihre
Ställe und versammelten sich auf dem Dorfplatz, begleitet vom Geblaff
der Hunde. Dieses rundum gehende Hirtenamt funktionierte in unserem
Dorf so gut, weil hier die Menschen gut miteinander umgingen. Es gab
viel Nachbarschaftshilfe. Wir haben immer noch ein System, das Städter
nur erstaunen lassen kann: Wir haben z.B. einen Maulesel nur zur Hälfte
oder zu einem Drittel. Warum sollten wir pro Familie ein Maultier haben,
wenn man es genausogut mit einer oder zwei Familien teilen kann? Wir
brauchen es ja nicht ständig, und so werden die Kosten vermindert.
Heute noch hat das Dorf ein halbes Maultier. So könnt ihr die Menschen
hier auch darüber reden hören, daß sie ein halbes Schwein
schlachten, was Städter sicher sehr komisch finden. Aber die meisten
Menschen sind hier jetzt zu alt, um in einem Jahr ein ganzes Schwein
zu essen, darum tun sie sich mit einem Nachbarn zusammen.